In China gibt es einen jungen Trend, der sich xié xiū nennt, wörtlich: Kultivierung des Bösen. Da das Böse (xié 邪) in Form von Katastrophenmythen oder Weltuntergangsphantasien in der chinesischen Kultur nie ein bedeutsamer Topos war (Schmidt-Glinzer 2009: 80), ist der Begriff ironisch zu verstehen.
Er bezeichnet Praktiken des Alltags, die mit gängigen Konventionen brechen, was sich ebenso auf ungewöhnliche Kochmethoden beziehen kann wie auf schräge Avatare am Arbeitsplatzcomputer. Die Frage ist, wie man dieses Phänomen deutet. Ist es ein Ausdruck wachsender Individualisierung in der chinesischen Gesellschaft? Oder nur die Lust an der Provokation?
Möglicherweise ist auch einfach nur Experimentierfreude am Werk; die zeigt sich in China vor allem an der Technikbegeisterung. „Es ist bemerkenswert, wie sich die Chinesen auf jede neue Technologie stürzen und gar nicht genug davon bekommen können“ urteilt der seit vielen Jahren in China lebende Journalist Frank Sieren ( 2021: 116).
Wahrscheinlich aber trifft alles gemeinsam zu. Ein Beitrag der «South China Morning Post» sieht denn auch Einflüsse der Anime-Kultur wie des Daoismus am Werk. Für letzteres ist die Idee des langen Lebens zentral (Kaltenmark 1979: 41). Damit gerät xié xiū zu einer popkulturellen Form der Weltbewältigung, sich stilvoll durch den Alltag zu wursteln.
Literatur
Kaltenmark, Max. 1979. „The Ideology of the T’ai-P’ing Ching‟, in: Facets of Taoism: Essays in Chinese Religion, hrsg. von Holmes Welch u. Anna Seidel. New Haven u. London: Yale University Press, S. 19-52.
Schmidt-Glinzer, Helwig. 2009. Wohlstand, Glück und langes Leben: Chinas Götter und die Ordnung im Reich der Mitte. Frankfurt/ Main und Leipzig: Verlag der Weltreligionen.
Sieren, Frank. 2021. Shenzhen: Zukunft Made in China. München: Penguin.
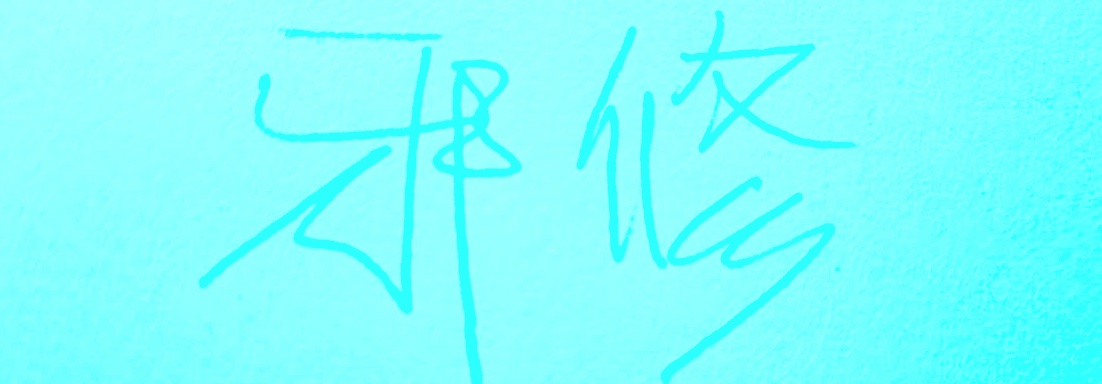
Schreiben Sie einen Kommentar