Schon vor zweihundert Jahren hat sich ein Alexander Puschkin darüber amüsiert, dass viele Literaten seiner Zeit eine Neigung zum geschwollenen Ausdruck haben.
“Was soll man von unseren Schriftstellern sagen, die es für unwürdig halten, die allergewöhnlichsten Dinge einfach beim Namen zu nennen, und meinen, sie können ihre naive Prosa durch Zusätze und welke Metaphern beleben?” schrieb der russische Autor.
Ja, was soll man von ihnen sagen? Ein Beispiel für Puschkins Beobachtung liefert dieser Tage ein Thomas Melle (von dem ich nie zuvor gehört hatte) in seinem Roman “Haus zur Sonne”, der bei Kritikern derzeit hoch im Kurs steht.
Über den Inhalt kann ich nichts sagen; vielleicht ist die Geschichte, die der Autor erzählt, der Lektüre wert. Aber die Sprache ist es nicht, liest man nur einmal die ersten Seiten. Schon der erste Absatz ist ein sprachliches Desaster:
“Die Zusage steckte in einem bläulich schillernden Umschlag. Ich riss ihn auf, warf ihn achtlos auf den Boden, wo er beleidigt vor sich hin schimmerte (…).”
Wie bitte? Wie kann ein Umschlag, also ein Gegenstand, beleidigt sein? Wie kann etwas “beleidigt vor sich hin schimmern?” Und dann wird im Satz zuvor von demselben Umschlag gesagt, er sei “bläulich schillernd”.
Schlimm genug, wenn Autoren glauben, derart verquaster Unsinn sei Literatur. Schlimmer freilich ist, wenn Literaturagenturen,Verlage und Kritiker sie in diesem Glauben bestärken.
Und in diesem Stil geht es weiter:
“Die Nachricht wühlte mich nicht auf, noch liess sie mich kalt.”
Warum schreibt der Autor nicht einfach, dass der Ich-Erzähler über die Mitteilung erleichtert war? Warum diese verquollene Sprache? Und weiter:
“Selbstverständlich freute ich mich. Aber ich freute mich auch über die Selbstverständlichkeit, mit der ich die Nachricht hinnahm.”
Versteht jemand, was hier gesagt werden soll? Wenn jemand etwas mit einer Selbstverständlichkeit zur Kenntnis nimmt, soll er sich über diese Selbstverständlichkeit freuen, weil ihn die Mitteilung nicht aufgewühlt … ach, es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken.
Dann kommt wieder der Umschlag ins Spiel:
“Ich hob den Umschlag wieder vom Boden auf, hielt ihn ins Licht und betrachtete das matte, funkelnde Blau, das im Rhythmus meines Pulses zitterte.”
Ist das einfach nur schlechte Literatur oder schon eine Parodie auf Literatur?
Als nächstes trinkt der Ich-Erzähler eine Cola. Nein, nicht einfach eine Cola, sondern:
“Die Cola, die ich jetzt trank, schmeckte wie eine fade, verblassende Erinnerung an meine dunkelsten Zeiten: klebrig, chemisch, charakterlos.”
Man sagt von Zeiten, dass sie “dunkel” waren, wenn sie mit Unheil verbunden sind. Hier sind die dunklen, ja sogar dunkelsten Zeiten jedoch charakterlos, dann aber auch wieder klebrig.
Oder ist die Erinnerung an sie klebrig, während jene fade ist wie eine Cola und verblasst? Warum schreibt der Autor nicht einfach, dass ihm beim Geschmack einer schalen Cola die Erinnerung an düstere Zeiten hochkommt?
Jedenfalls beenden wir damit unseren kleinen Ausflug in die düster-klebrige Gegenwart der verblassenden, beleidigt vor sich hin schimmernden deutschen Gegenwartsliteratur und lesen doch lieber wieder Puschkin.
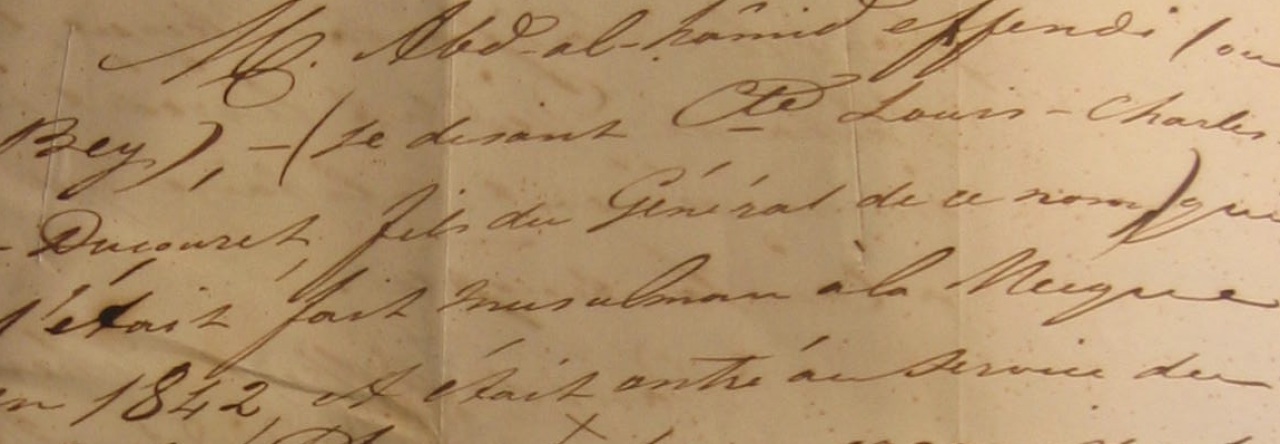
Schreiben Sie einen Kommentar