Ich habe einmal einen Vortrag zum Nahostkonflikt gehalten und kam anschliessend mit einigen Zuhörern ins Gespräch. Als ich einer älteren Dame sagte, dass die antisemitische Propaganda einschliesslich der Leugnung des Holocaust noch nicht einmal das Schlimmste in den arabischen Ländern sei, da schaute sie mich mit grossen Augen an und fragte: «Nicht? Was könnte denn noch schlimmer sein?»
Autor: Michael Kreutz Seite 1 von 16
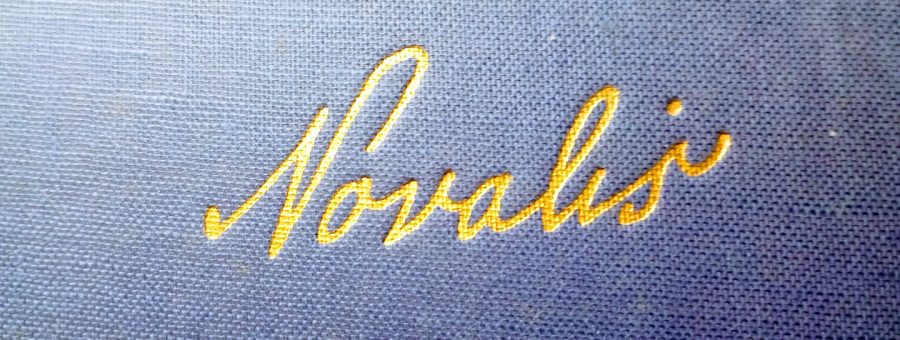
Zwei Gedanken von Novalis (1772-1801) aus dem Essay «Die Christenheit und Europa» und einer aus den «Blütenstaub»-Notaten, gefunden in den «Gesammelten Werken», Gütersloh 1967:

Am 25. November 2007, also ziemlich genau vor achtzehn Jahren, fuhr ich von Erfurt, wo ich damals an der Universität arbeitete, nach Berlin, um mit Gleichgesinnten eine deutsche Zweigstelle («chapter») des Hochschulvereins SPME zu gründen, der sich gegen Antisemitismus an Hochschulen einsetzt.

Bin ich eigentlich der einzige, dem das auffällt? So habe ich lange Zeit gedacht. In den zahlreichen Romanen, die ich gelesen oder angelesen habe, finde ich neben Stilblüten vor allem langatmige Reflexionen und Betrachtungen, überhaupt eine zähflüssige Fabulierei, der allerdings kaum Handlung, kaum Plot gegenübersteht. Nun, ich bin wohl doch nicht der einizge, der das moniert, wie ein Kommentar in der NZZ zeigt:

Eine politikwissenschaftliche Studie der Universität Mainz versucht, Antworten zu geben und Ursachen für Islamfeindlichkeit (Islamophobie») in Europa zu benennen:

Aus einem Reisebericht über Palästina, verfasst von einem Friedrich Temme, über den ich nichts weiter in Erfahrung bringen konnte, und erschienen in Bonn 1903, findet sich auf S. 142 folgende Mitteilung über einen Aufenthalt in Schechem (Sichem):

Kontingenz, also die Offenheit historischer Entwicklung, ist seit langem ein populäres Schlagwort unter Historikern, Soziologen und Philosophen, was insofern erstaunt, weil das Gegenteil, die Geschichtsteleologie, also der Glaube an eine innere Logik der Geschichte, in den Geisteswissenschaften vor langem ad acta gelegt wurde.

Vor vielen Jahren habe ich einmal auf einer Tagung ein Panel zum Thema Islamismus und Rechtsextremismus moderiert, bevor mir später die Mitherausgeberschaft des Tagungsbandes angetragen wurde. Als Mitherausgeber hätte ich die Gelegenheit gehabt, mit einem eigenen Beitrag zu glänzen. Diesen stelle ich nun gratis zum Download bereit.

Wenn ich Wing Tsun praktiziere, dann in der Absicht, mit der Zeit ein immer tieferes und reflektierteres Verständnis für die Kampfkunst zu gewinnen. Manchmal gibt es dann kleine Momente der Erleuchtung, die mich auf eine Spur führen, der ich nachgehe.
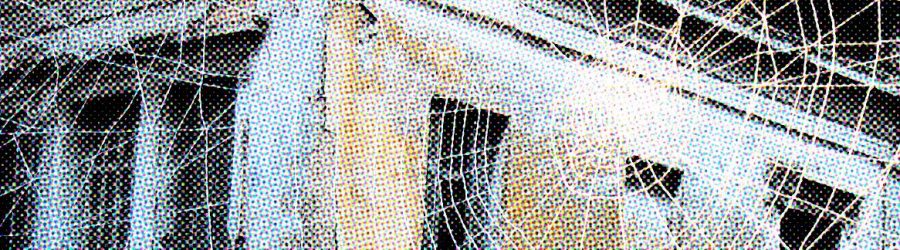
Wieder und wieder fallen westliche Beobachter auf die Inszenierung des Khomeini-Regimes herein, Iran als normales Land darzustellen, das lediglich zwischen Hardlinern und Reformern gespalten sei, wo doch in Wahrheit die Mehrheit der Iraner die Diktatur ablehnt. Einer, der dieses Spiel durchschaut hat, ist der kroatische Reiseschriftsteller Claudio Magris.
